„Ein positives Bild von Familie in der Gesellschaft zeichnen“
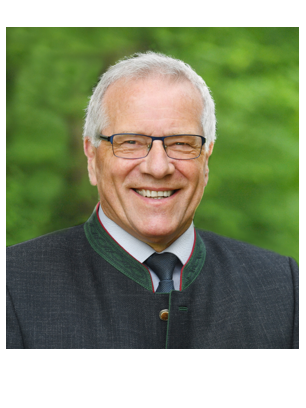
„Familie ist das Erste, was der Mensch im Leben vorfindet und das Letzte, wonach er die Hand austreckt“, mit diesem Zitat von Adolph Kolping spannte Staatssekretär a.D. Hintersberger, den der Sachausschuss Ehe und Familie des Diözesanrates zu einem Expertengespräch eingeladen hatte, den großen Bogen der Familienpolitik auf. Die Veranstaltung war darauf ausgelegt, zum einen von kompetenter Seite über die geplanten Maßnahmen der Ampelkoalition zu informieren um dann zu überlegen, wie der Diözesanrat auf politische Entscheidungen im Sinne einer christlichen Werteorientierung Einfluss nehmen könne.
In einem Überblick wies Hintersberger nicht nur auf die evolutionsgeschichtliche Bedeutung von Familienverbänden und-strukturen für die Erhaltung und den Schutz der Stammesgemeinschaft und der Gesellschaft hin, sondern richtete den Blick insbesondere darauf, dass die Achtung vor und der Wert der Familie explizit im Grundgesetz (§6) der nach dem Zweiten Weltkrieg neu gegründeten Bundesrepublik Deutschland und zuvor bereits in der Bayerischen Verfassung (Art. 124 und Art. 125) verankert worden seien.
§ 6 Grundgesetz
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) 1Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 2Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(…)
Art. 124 Bayerische Verfassung
(1) Ehe und Familie sind die natürliche und sittliche Grundlage der menschlichen Gemeinschaft und stehen unter dem besonderen Schutz des Staates.
(…)
Art. 125
(1) 1Kinder sind das köstlichste Gut eines Volkes. 2Sie haben Anspruch auf Entwicklung zu selbstbestimmungsfähigen und verantwortungsfähigen Persönlichkeiten. 3Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge des Staates.
(…)
Hinsichtlich der zahlreichen, im Koalitionsvertrag beschriebenen Änderungsvorhaben im familienpolitischen Bereich, die eine zum Teil erhebliche Werteverschiebung zur Folge hätten und deshalb vom Diözesanrat mit großen Bedenken betrachtet werden, beruhigte Hintersberger. „Koalitionsverträge spiegeln einen Verhandlungsstand mit den jeweiligen Parteien wider und sind noch kein Gesetz. Ob tatsächlich alles so verwirklicht wird, wie es jetzt auf dem Papier steht, ist durchaus offen.“ Nichts desto trotz bemerkte er selbstkritisch, dass auch die CSU als Partei mit erwiesenermaßen familienpolitischem Schwerpunkt, sich das Thema öffentlich nicht deutlich genug zu eigen gemacht habe. „Im politischen Tagesgeschäft werden leider oft andere Dinge als vorrangiger und wählerwirksamer eingestuft.“ Auf der Klausurtagung habe man „Familie“ aber als Schwerpunkt ganz oben auf die Agenda gesetzt, noch vor „innere Sicherheit“ und „Bildung“. Das sei ein deutliches Signal, wie ernst man die Thematik nehme.
Sehr deutlich bezog Hintersberger im Laufe der regen Diskussions- und Fragerunde der anwesenden Diözesanratsmitglieder Position für eine klare, christlich orientierte Haltung des Lebensschutzes von der Zeugung bis zum Lebensende. Er warb dafür, auf politischer Ebene immer wieder Entscheidungen gut zu begründen und für die Bürger nachvollziehbar zu machen, im medialen Bereich offensiver für ein positives Bild der „Kernfamilie“ zu sorgen, statt diese als Ausnahmeerscheinung darzustellen (was sie empirisch- und statistisch gesehen gar nicht ist) und im persönlichen Umfeld überzeugend für gelingende Beispiele von Familie und deren nachhaltiger Bedeutung einzutreten. „Jeder von uns kann dazu beitragen, dieses Bild von Familie in der Öffentlichkeit zu transportieren. Best Practice wirkt auch am besten!“
Gegenstand des Gesprächs war auch noch einmal die Abschaffung des §219a (Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche), die, so die Befürchtung einiger, den Schritt hin zum Schwangerschaftsabbruch erleichtere und damit der Schutz des ungeborenen Lebens, zugunsten der Selbstbestimmung der Frauen, zunehmend aus den Augen verloren werde. Berechtigung der sozialen Indikation und die Rolle der Familie als Rückhalt in schwierigen Situationen und als Unterstützung in Notlagen wurden zum Teil kontrovers diskutiert. Dabei kam auch zur Sprache, dass sich der Diözesanrat als oberstes Laiengremium deutlich gegen eine Abschaffung des §219a ausgesprochen, man aber ein ebenso eindeutiges Votum von Seiten der „Amtskirche“ vermisst habe.
Auch beim Thema „Verantwortungsgemeinschaft“, der nach dem Willen der Ampelkoalition gleiche Rechte wie einer herkömmlichen ehelichen Beziehung (Mann/Frau) im Hinblick auf die Kindererziehung zugesprochen werden sollen, gab es unterschiedliche Standpunkte. Eingewandt wurde, ob eine Haltung des Beharrens in gewohnten bzw. tradierten Formen und der Restriktionen dauerhaft nicht eher nachteilig für die Betroffenen (z.B. Frauen oder Kinder) sei. „Wir müssen uns überlegen, wo rote Linien sind, die wir wirklich nicht überschreiten wollen und wo wir Kompromisse eingehen können. Es gibt auch andere Verbindungen zwischen Menschen, die Verantwortung, Respekt, Liebe und Achtung füreinander aufbringen.“ Dem gegenüber stand die Position, dass eben nur die Verbindung von Mann und Frau zu neuem Leben führe und eine Gesellschaft sich in Zukunft selbst demontiere, wenn dies relativiert würde.
Angesprochen wurden auch so unterschiedliche Aspekte wie fehlende oder geringere finanzielle Leistungen für Frauen in der Kindererziehung oder in der Pflege älterer Familienangehöriger (im Vergleich zu den Leistungen bei Inanspruchnahme der staatlichen Einrichtungen), die niederschwellige Möglichkeit der Geschlechtsumwandlung bereits in sehr jungen Jahren, die Frage der Leihmutterschaft, die Abschaffung des Ehegattensplittings und vieles mehr.
Die Ermutigung, an den Themen dranzubleiben und sie in der Öffentlichkeit präsent zu halten, stand als Fazit am Ende eines konstruktiven Diskurses in Sachen „Familienpolitik“.
Susanne Kofend, Geschäftsführerin Diözesanrat