Gender - ein Thema mit überraschenden Einsichten
Wohl selten ist eine Vollversammlung des Diözesanrats, was ihren thematischen Teil betrifft, mit so viel Spannung erwartet worden, wie die zum Thema „Gender – Herausforderung für Christen“. Denn diesbezüglich herrscht eine im Grunde genommen unversöhnliche Uneinigkeit unter den Katholiken: Während viele Verbände Gender-Mainstreaming in ihre Grundsätze aufgenommen haben, sehen Konservative in der Genderlehre und ihrer Anwendung (dem „Mainstreaming“) eine Leugnung der Geschlechtsunterschiede und einen Brückenschlag zu den Positionen der LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) –Lobby. Würde es diesmal also „so richtig krachen“ in der Diözesanratsvollversammlung?
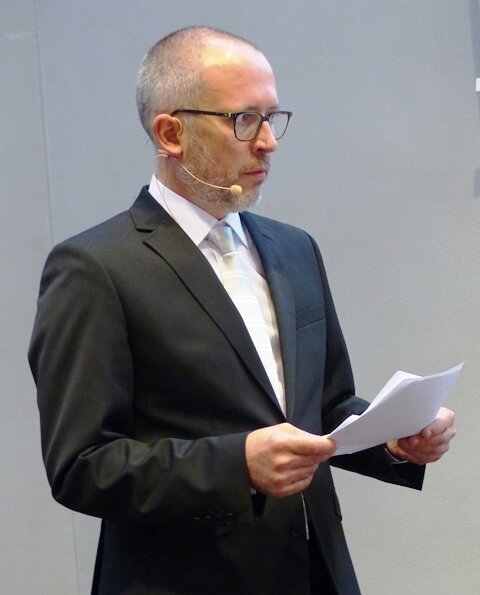
Dass das nicht soweit kam, ist möglicherweise der humorvollen und bodenständigen Moderation von Peter Hummel zu verdanken (was nicht heißen soll, dass die Teilnehmer sich ohne ihn spinnefeind gewesen wären). Jedenfalls wurde die Vollversammlung zu einer äußerst informativen und spannenden Veranstaltung, die wohl keiner der Beteiligten ohne das Gefühl verließ, etwas für ihn Neues oder Interessantes gelernt zu haben.
Vorbereitet hatte den thematischen Teil der Vollversammlung der Sachausschuss "Ehe und Familie" unter der Leitung von Pavel Jerabek. In der Vollversammlung war es dann Sachausschussmitglied Alex Barth, welcher die Referenten und Podiumsteilnehmer der Vollversammlung zum Thema "Gender" begrüßte und mit einem Gebet für den himmlischen Beistand sorgte.
Doch der Reihe nach:

Werkstattbericht des Generalvikars
Jede Vollversammlung beginnt am Freitagnachmittag mit der heiligen Messe, die in der Regel der Bischof selbst zelebriert. Auch diesmal schlossen sich die Berichte des Generalvikars und der Vorsitzenden des Diözesanrates an. Msgr. Harald Heinrich berichtete von den noch laufenden Visitationen, die auch die Möglichkeit bieten die verschiedenen Vorhaben „Raumplanung“ zu prüfen und auszurichten. In enger Verbindung damit stehen die Ausgaben der Diözese, insbesondere der sog. Instandsetzungsetat, der in diesem Jahr bei 37 Mio. EUR liegt, um Sanierungen/Renovierungen zu ermöglichen. „Wo brauchen wir überall Pfarrbüros? Wie schaut es mit Versammlungsräumen in den Pfarreien aus – ganz konkret: Wie viele Pfarrheime können wir uns leisten und vor allem auch im Blick auf die konkreten Zahlen und Bedürfnisse der Pfarreien – brauchen wir wirklich?“ Auch sollen die Pfarreiengemeinschaften und größeren Pfarreien von einem Übermaß an Verwaltungsarbeit entlastet werden. Deshalb sind derzeit auf knapp 17 Planstellen 22 Verwaltungsleiterinnen und Verwaltungsleiter tätig. Ein neuer Berufszweig also, der Kirchenpfleger und Kirchenverwaltungen entlastet, z.T. bereits auch ersetzt. In anderen Personalbereichen kann man weniger von Aufbau und Ausbau sprechen, sondern muss von einem Rückgang ausgehen, nicht nur was die diözesanen Priesterberufungen betrifft (auch wenn es da jüngst eine Aufwärtsbewegung gab), sondern vor allem was die Stellen für Gemeindereferenten betrifft. Letztere bleiben nämlich in Ermangelung von Bewerbern oder Zugriff der Kandidaten auf die Stellen zu oft unbesetzt, während Stellen für Priester noch ganz gut ausgefüllt werden durch ausländische Priester. Diese verfügen nämlich auch über eine große Flexibilität, was ihren Einsatzort betrifft, während hauptamtliche Laien durch ihre Familien stärker an die Standorte der Schulen, die ihre Kinder besuchen, und deren Freundeskreis gebunden sind. (siehe am Ende des Artikels den vollständigen Bericht)

Auch der Bericht der Diözesanratsvorsitzenden enthielt erheblich mehr Aspekte, als hier dargestellt werden können. Er befasste sich zunächst mit der weltpolitischen Situation und mit einem Aufruf an die Christen, sich nicht verunsichern oder gar verhetzen zu lassen. Weiters forderte Hildegard Schütz die Vollversammlungsteilnehmer auf, sich gut zu informieren und selbst zu Meinungsmachern zu werden: „Mischen wir uns ein!“ Ein weiterer wichtiger Aspekt ist es, sich nicht damit zu begnügen, Opfer oder gar Täter in der virtuellen Welt zu werden, sondern auf die Menschen zuzugehen, sie ihr Leben und ihre Kultur, ihre Religion und ihre Familien kennen zu lernen. „Seien wir Zeugen in der Welt!“ Als einen herausragenden Zeugen Christi in der Welt zeichnete Hildegard Schütz sodann Papst Franziskus, der uns auffordert, engagierte und unbequeme Europäer zu sein. Dieses Engagement zu fördern, ist auch Anliegen des Konzepts „Kirche und Kommune – gemeinsam für soziale Gemeinden“, für das die Vorsitzende gemeinsam mit Staatsminister a.D. Josef Miller und anderen alle Dekanate besucht. In diesen Netzwerkveranstaltungen möchte der Diözesanrat auch immer wissen, was er für die Ehrenamtlichen tun kann, und es ist ein starkes Bedürfnis nach einer stärkeren Wertschätzung ihrer Arbeit (bis hin zur finanziellen Entschädigung) festzustellen.
Aktuelle Zeitungsberichte waren es dann noch, die nicht nur Schütz, die selbst Lehrerin ist, sondern auch Bernhard Rößner, ebenfalls Lehrer und Leiter der Abteilung Schule und Religionsunterricht des Bistums, auf den Plan riefen. So wurde berichtet, dass immer weniger Schüler den konfessionell geprägten Religionsunterricht in Bayern besuchten und stattdessen Ethik wählten. Diese Zahlen vermitteln jedoch ein falsches Bild, so als ob der Religionsunterricht unbeliebt sei, während in Wirklichkeit andere Faktoren, z.B. zurückgehende Schülerzahlen und eine veränderte Schülerstruktur (d.h. mehr Schüler mit Migrationshintergrund) verantwortlich sind. (siehe am Ende des Artikels den vollständigen Bericht von Hildegard Schütz)
|
Gendersprache als Herrschaftsinstrument


KDFB: "Das verstehen wir unter Gender-Mainstreaming"


Einig waren sich nun aber alle Teilnehmer über die Forderungen von Sabine Slawik, nur dass sie anstelle der Gender-Begrifflichkeit lieber Geschlechtergerechtigkeit und Geschlechtersensibilität sähen, da sich hinter dem Genderbegriff eigentlich etwas ganz anderes verberge, als jeden Menschen rechtlich und politisch gleich zu behandeln und seine Geschlechtsidentität zu berücksichtigen. Was ist nun der wahre Genderbegriff? Und wie steht der KDFB zu den von den Genderkritikern angesprochenen Punkten? Diese Fragen blieben letztlich offen, auch wenn der Wunsch geäußert wurde, die Verbände möchten sich doch einer anderen Begrifflichkeit bedienen. So wurde aus einer Vollversammlung, in der viele Sprengstoff vermuteten, eine recht informative und keineswegs unversöhnliche Veranstaltung.
Michael Widmann



