"Gott ist ein Freund des Lebens"

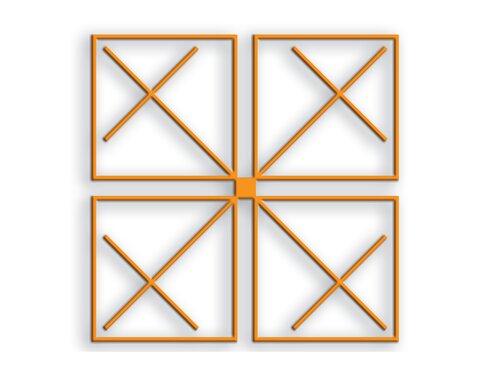

Nach der Vesper in der Hauskapelle mit dem Bischöflichen Beauftragten des Diözesanrats, Prälat Dr. Bertram Meier, und der Begrüßung durch Diözesanratsvorsitzende Hildegard Schütz begann dann die Informationsveranstaltung auf hohem fachlichen Niveau: mit einem Vortrag des Freiburger Moraltheologen Prof. Dr. Eberhard Schockenhoff. Dieser führte gleich zu Beginn einen Aspekt an, der mit ein Grund für die Fachtagung war, nämlich dass das Thema „Abtreibung“ im Grunde genommen im öffentlichen Diskurs nicht präsent ist. Die Schwierigkeit, für den Lebensschutz einzutreten, bestehe darin, eine wertschätzende Sprache zu pflegen: einerseits die betroffenen Frauen nicht zu verurteilen und andererseits die Schutzwürdigkeit des menschlichen Lebens klar zu vertreten sowie das Unrecht des Schwangerschaftsabbruchs klar zu benennen.
Wertschätzende Sprache in Konfliktsituationen
Die in der Gesellschaft vorherrschende Auffassung gehe von einem Verfügungsrecht über den Embryo aus. Dadurch werde dessen moralischer Status als Mensch herabgestuft, indem ihm nur eine eingeschränkte Schutzwürdigkeit zukommen soll. Dies sei von den sicheren Erkenntnissen über die Entstehung und Entwicklung des menschlichen Leben her eigentlich ausgeschlossen: Vom Punkt der Empfängnis beginne ein neues menschliches Leben in seiner Einmaligkeit, mit seinem individuellen genetischen Erbe. Bei Erhalt der notwendigen Unterstützung entwickle sich aus dem jungen menschlichen Lebewesen ein erwachsener Mensch.
Das Verfügungsrecht über den Embryo werde andererseits aus dem Selbstbestimmungsrecht der schwangeren Frau abgeleitet. Schockenhoff wies darauf hin, dass das Selbstbestimmungsrecht als ein ethisch eigenverantwortliches Handeln aber nicht erst mit der Schwangerschaft beginne, sondern mit dem Sexualverhalten. Beide Begründungsstrategien zugunsten eines moralischen Rechts, über die Schwangerschaft zu verfügen, blendeten die Perspektive des Kindes vollkommen aus. Sie würden nicht anerkennen, dass es sich um einen Dreierkonflikt handle, in dem der Vater die stärkste Position innehabe, weil er sich herausnehmen könne, während das Kind die schwächste Position einnehme. Die Mutter befinde sich mit ihrer neunmonatigen Symbiose mit dem Kind in einer einmaligen Situation, die es sonst im Leben nicht gebe. Sowohl der Würde der Frau als auch der Würde des Kindes sei Rechnung zu tragen. „Weil diese Konfliktsituation so einzigartig ist, ist es auch schwer, in einer wertschätzenden Sprache darüber zu sprechen.“

Die 1976 eingeführte Indikationenregelung (medizinische, eugenische, kriminologische und soziale Indikation) war ja nach der Wiedervereinigung 1992 durch eine Fristenregelung (Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten drei Monate nach Konfliktberatung straffrei) mit zusätzlich zwei Indikationen (Abtreibung bei Vorliegen einer medizinischen oder kriminologischen Indikation nicht rechtswidrig) ersetzt worden.
Schockenhoff legte nun dar, dass die eugenische Indikation durch eine erweiterte medizinische Indikation ersetzt wurde, nach der es für die Mutter eine unzumutbare Beeinträchtigung darstelle, mit einem behinderten Kind zu leben. Als Rechtfertigung habe man schwerste Behinderungen angeführt, die eine 24-stündige Rundumbetreuung erforderten, was in der Tat eine schwere Belastung vor allem der Mutter darstelle, welche auch deren Gesundheit abträglich sein könne. Angewendet werde diese Indikation jedoch auch bei Trisomie 21, einer Behinderung, die lt. Schockenhoff dem Selbstbild der Mutter widersprechen mag oder von ihr als Kränkung erlebt werden könne, jedoch nicht für die ursprüngliche Begründung der Indikation tauge: von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung der Mutter könne generell nicht ausgegangen werden.
Genetische Rasterfahndung
Eine eugenische Indikation, die es damit de facto gibt, laufe zudem auf eine Ungleichbehandlung menschlichen Lebens hinaus. Das Leben des voraussichtlich behinderten Menschen werde unzulässigerweise bewertet, indem man ihm „ein solches Leben ersparen“ wolle. Dabei sei es schlichtweg nicht möglich, von außen das Glück eines Lebens zu bewerten, erst recht nicht mit dieser Konsequenz. Die Lebensqualität des behinderten Menschen hänge ja gerade auch von der Hilfestellung just derjenigen ab, die in der Frage des Schwangerschaftsabbruchs das Urteil fällten, ob das Kind leben dürfe.

Die Entscheidungsfindung einer Frau im Falle eines Schwangerschaftskonflikts schilderte Schockenhoff als eine tragische Situation: denn die komplexe Rechtslage sei nicht ins allgemeine Bewusstsein eingedrungen, viele dächten der Schwangerschaftsabbruch sei rechtmäßig, ja die Frau habe geradezu ein Recht darauf. Hier bleibe dem Rechtsstaat und seinen Verteidigern nichts anderes übrig, als immer wieder die Einsichtswerbung zu erproben. Schockenhoff konstatierte nüchtern, dass das frühere gesetzliche Verbot der Abtreibung generell der Frau eine stärkere Position verschafft habe. Gegenüber jedem, der sie zu einem Schwangerschaftsabbruch habe drängen wollen, konnte sie sagen: „Du willst mich zu einem Verbrechen zwingen“, heute könne sie das nicht mehr sagen. Das strafbewehrte Verbot habe nicht den Sinn gehabt, Frauen zu kriminalisieren, sondern alle davon abzuhalten, Unrecht zu begehen.
Oft zögen sich die Männer im Konfliktfall aus der Affäre mit dem Standpunkt: „Das musst du entscheiden“, aber das heiße nichts anderes als: „Du musst auch die Folgen alleine tragen“. Hier bedürfe es einer anderen Kultur unserer gesellschaftlichen Mentalität. Denn das Alleinlassen der Frau sei moralisch nicht anders zu beurteilen als der Abbruch selbst. Entsprechend litten auch Männer noch Jahrzehnte danach darunter, sich aus der Affäre gezogen oder ihre Partnerinnen direkt zur Abtreibung veranlasst zu haben. Dies bekannten Männer in einem Beitrag des ZEIT-Magazins vom Februar 2009.
Als eine weitere „tragische Verhakung des Problems“ betrachtete es Schockenhoff, dass in der öffentlichen Debatte ein „Recht zum Schwangerschaftsabbruch“ behauptet werde, eine Art „Grundrecht, mit dem die weibliche Autonomie und Emanzipation steht und fällt“. Tatsächlich sei aber eine Abtreibung selten ein Akt der Autonomie; diese werde vielmehr von vielen Frauen „ als ein aufgezwungener Akt der Selbstschädigung empfunden, der sie im innersten Kern ihrer Persönlichkeit verletzt. Insofern zerstört der Schwangerschaftsabbruch nicht nur das Leben des Kindes, sondern auch die Integrität und Würde der Frau.“ Die Abtreibung bedrohe „ihre physische und psychische Gesundheit, ihre eigenen Lebensperspektiven ihre persönliche Werteinstellung und ihr moralisches Selbstbild, zu dem der gegen das Leben gerichtet Akt der Abtreibung im Widerspruch steht.“ Die Mehrzahl der betroffenen Frauen erlebe eine Abtreibung jedoch als „eine Niederlage, als eine schwere Kränkung und als Ausdruck demütigender Abhängigkeit. Weil der öffentliche Diskurs über die Abtreibung zumeist einseitig im Zeichen der Befreiung und Emanzipation von Frauen und von ihrem abstrakten Selbstbestimmungsrecht hergeführt wird, rückt das tatsächliche Ausmaß der Verletzung in den Hintergrund, die viele Frauen durch einen Schwangerschaftsabbruch oder durch mehrere dauerhaft erleiden. Die ausweglose Tragik vieler Schwangerschaftskonflikte besteht darin, dass die schwangere Frau zum isolierten Einzelwesen wird, das einsam darüber entscheiden muss, was mit ihr und mit ihrem Kind geschehen soll.“
Umgekehrt empfänden sich auch Väter häufig als ausgeschlossene Dritte. Letztlich fände ein Schwangerschaftskonflikt fast immer in einer Dreieckskonstellation statt. Dieses Bewusstsein sei wichtig. Die Bewusstseinsbildung beginne jedoch bereits damit, gemeinsam Verantwortung für die gemeinsame Sexualität zu übernehmen.
Von angetasteter Würde
„Das Recht auf Leben in Politik und Gesellschaft“ lautete der Titel des Vortrags von Christiane Lambrecht. Die Landesvorsitzende der Christdemokraten für das Leben (CDL) in Bayern stellte gleich zu Beginn fest, dass die seit 70 Jahren bestehenden Grundrechte von der unantastbaren Würde des Menschen (Art. 1) und vom Recht auf Leben (Art. 2) mittlerweile als angetastet zu gelten hätten und zwar „durch staatliche Gesetze, durch rechtliche Konstrukte, die im Deutschen Bundestag durch Mehrheitsbescheide beschlossen wurden“ und das „hunderttausendfach im Jahr“. Der Umgang des Menschen mit den Ungeborenen werde auch unabhängig von den hunderttausend Abtreibungen pro Jahr immer bedenklicher. Lambrecht wies auf „Designerkinder“ mittels Genmanipulation, auf Kinder mit drei Müttern mittels Leihmutterschaft und auf „Kinder mit und ohne Qualitätssiegel“ durch vorgeburtliche Tests auf mögliche genetische Auffälligkeiten hin, Tests, die ab Herbst zur staatlich finanzierten Leistung werden sollten.

An diesem Zitat wird eine mittlerweile „Framing“ genannte Technik der Kommunikation erkennbar, nämlich bestimmte Themen durch eine Rahmensetzung eindeutig positiv oder negativ zu besetzen. Die Sachgerechtigkeit spiele dabei keine Rolle, es gehe um Meinungsmache, bis hin zur Manipulation. So werde ein Embryo als „Schwangerschaftsgewebe“ bezeichnet oder von einem „Recht auf Abtreibung“ gesprochen. Abtreibungsbefürworter würden ja nur den Frauen „helfen“ und zu Opfern der Lebensrechtsbewegung, die sich gegen weibliche Selbstbestimmung wende und „zurück ins Mittelalter“ wolle.
Auf diese Weise sei die Krise beim Lebensschutz „eine Krise von Werten und Wahrheit“, da das Selbstverständlichste nicht mehr als solches wahrgenommen werden würde. Dazu zählt Christiane Lambrecht das Recht auf Leben. Dieses sei kein christliches Sonderrecht, sondern ein vorstaatliches Recht, ein Menschenrecht, das sich alleine auf die Zugehörigkeit zur menschlichen Spezies gründe.
Dass ein Embryo ein Mensch sei, werde durch die vier naturwissenschaftlich belegten SKIP-Kriterien gezeigt, nach den Anfangsbuchstaben S für „Spezies“, K für „Kontinuität“, I für „individuelle Identität“ und P für „Potential“. Lambrecht wörtlich:
Das „S“ bedeutet die Entstehung einer definierten Spezies (hier: „Mensch“) durch die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle.
„K“ steht für ungebrochene Kontinuität, also dem wachsen bis zum erwachsenen Menschen.
„I“ meint die individuelle Identität des neuen Menschen durch die Fusion des mütterlichen und väterlichen Genoms –die eindeutige DNA.
Und das „P“ steht für Potential, wissenschaftlich ausgedrückt für die Totipotenz der befruchteten Eizelle, denn aus der einen Eizelle entwickelt sich ein vollständiger Mensch.

Schon jetzt würden Embryonen nicht nur durch Abtreibungen getötet, sondern auch durch Selektion in der Petrischale, verbrauchende Forschung und Genmanipulationen. Außerdem würden überzählig hergestellte Embryonen, z.B. für die künstliche Befruchtung, tiefgefroren, in Deutschland allein 20.000 bis 60.000 Menschen, denen bei minus 196 Grad die Weiterentwicklung und der Eintritt in die menschliche Gemeinschaft, also das Leben, verwehrt werde.
In der offiziellen Statistik mit den über hunderttausend Abtreibungen tauchten die medikamentösen Abtreibungen durch die sog. „Pille danach“ und die „Abtreibungspille“ (Mifegyne) nicht auf. In den Beratungsstellen von „Pro Familia“ erhalte die schwangere Frau innerhalb von fünf Minuten nach Ausfüllen der Personalien und ohne Angabe von Gründen oder einem Beratungsgespräch den Beratungsschein. Seit 1995 würden offiziell 1,5 Millionen Kinder abgetrieben. Die meisten Abtreibungen würden zunächst über die Krankenkassen bezahlt, die sich dann zu 75 % das Geld vom Staat, von unseren Steuergeldern, zurückholten. „Insofern kann man sagen, dass unser Staat Abtreibungen finanziert.“
Wir brauchen einen Kulturwandel
Angesichts dieses „Horrorszenarios“ appellierte Christiane Lambrecht an die Teilnehmer der Fachtagung: „Wir brauchen eine Kehrtwende. Es gibt kein gutes Töten.“ Alle Regelungen müssten auf den Prüfstand. Es bedürfe einer Gesellschaftsänderung hin zum Guten. „Wie wir mit den Schwächsten umgehen, das wird unsere Kultur weiterhin prägen. Wir brauchen einen Kulturwandel.“
Das Manuskript des Referats von Frau Lambrecht können Sie mit der kompletten Rede hier einsehen:
Dass dieses Anliegen eines Kulturwandels in der Kirche eine lange Tradition hat, zeigte Maria-Anna Immerz für das Bistum Augsburg mit Hinweis auf Johann Evangelist Wagner (1807–1886), dem Seelsorger der Dillinger Franziskanerinnen und Regens des Dillinger Priesterseminars, Regens Wagner genannt, und Dominikus Ringeisen (1835–1904), dem Begründer der Ursberger Anstalt, dem heutigen Dominikus-Ringeisen-Werk. Nach dem Ersten Weltkrieg war dann aus christlicher Überzeugung in Augsburg ein Krippenverein für verwaiste Kinder gegründet worden, die Grundlage des Josefinums, heute ein Klinikum für Gynäkologie, Geburtshilfe, Pädiatrie und Kinderpsychiatrie. Zuvor schon, im Jahre 1912, war ein Fürsorgeverein für gefallene Mädchen entstanden, aus dem der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) hervorging. Diesem wurden lt. Immerz 1979 als Frauensozialfachverband die kirchlichen Schwangerenberatungsstellen übertragen, die es seit 1976 gab. Dort werden seit 1999 keine Bestätigungsscheine für Beratungsgespräche ausgestellt, die als rechtliche Grundlage für einen Schwangerschaftsabbruch gelten.

Maria-Anna Immerz, Bischöfliche Beauftragte für den Fachbereich Schwangerenberatung und SkF, berichtete von den Richtlinien der Bischöfe und der Rahmenkonzeption „Ja zum Leben“, deren Hauptsatz heiße: „Ziel der Beratung ist der Schutz des ungeborenen Kindes durch Unterstützung der Frau (und ihrer Familie) in allen Phasen der Schwangerschaft sowie nach der Geburt des Kindes“. Ihre Aufgabe, so Immerz, sei es, „dafür zu sorgen, dass in den katholischen Beratungsstellen das passiert, was von den Bischöfen gewollt ist“.
Außerdem berichtete sie über die Entstehung von „Pro Vita“ als zunächst dreijährige bewusstseinsbildende Aktion unter Bischof Viktor Josef Dammertz: Diese sei im Wesentlichen vermittels Anregungen für Pfarrgemeinden und mit Festen durchgeführt worden, die das Leben gefeiert hätten. Unter dem gleichen Namen sei im Jahr 1999 ein Bischöflicher Hilfsfonds gegründet worden, „wo Frauen und Familien, die durch Schwangerschaft und Geburt in finanzielle Nöten geraten sind, Hilfe finden“. Nach zwanzig Jahren könne man von einer durchaus stolzen Bilanz sprechen: 5,8 Mio. Euro seien an über 10.000 Familien verteilt worden. 2,2 Mio. Euro seien Spenden von Gläubigen aus dem Bistum Augsburg gewesen, der Rest aus Kirchensteuereinnahmen geflossen. Auch die Beratungsstellen würden von der katholischen Kirche bezahlt werden, der Staat würde nur einen kleinen Prozentsatz jährlich zuschießen.


In einer Gesellschaft, in der Kinder nach der vorgeburtlichen Diagnose einer zu erwartenden Behinderung in der Regel abgetrieben werden, ist die erwartbare Reaktion auf die Nachricht, das Kind werde entweder noch im Mutterleib oder bei der Geburt oder kurz danach sterben, vermutlich ein sicheres Todesurteil. Ein solches Kind erscheint nach den Maßstäben unserer Gesellschaft als sinnlos, sein Leben als zu gering, um irgendeinen Wert zu haben, es auszutragen und auf die Welt zu bringen als geradezu schockierend, monströs. Gleichwohl ist auch ein solches Kind ein Mensch, ein Träger von Würde und Rechten, ein geliebtes Kind Gottes.

Frau Starringer-Rehm berichtete von einer SkF-Kollegin, die in einer solchen Situation für eine Frau, ihr Kind und dessen Vater da war. Diese Frau hatte bereits ein Kind und befand sich in der 16. Schwangerschaftswoche. Bei einem Routineultraschall stellte die Gynäkologin fest, dass etwas nicht in Ordnung sei. Weitere Untersuchungen ergaben eine schwere Behinderung, dem Embryo wurden kaum Lebensschancen attestiert, sei es dass er noch während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder in den ersten Lebenstagen sterben würde. Die Eltern waren schockiert. Sie vereinbarten einen Termin für einen Schwangerschaftsabbruch. Auf dem Weg dorthin erkannten sie aber, dass dies nicht ihr Weg sein konnte. Ihr Pfarrer empfahl ihnen die bereits genannte Mitarbeiterin der Schwangerenkonfliktberatung des SkF. In den Gesprächen ging es zunächst einmal darum, beiden Elternteilen Raum und Zeit zu geben, ihre gesamten Gefühle, Sorgen, Bedenken und Enttäuschungen auszusprechen und zu reflektieren. Letztendlich mussten sie Abschied von der Vorstellung nehmen, ein gesundes Kind zu bekommen. Fragen stellten sich: Würde das Kind sehr leiden müssen? Wie wäre die Situation für das Geschwisterchen? Wie würde das Umfeld darauf reagieren? Sollten sie wirklich eine Schwangerschaft ohne Überlebenschancen fortführen? Mit der Entscheidung die sie jetzt fällten, das wurde ihnen klar, würden sie ihr Leben lang zurechtkommen müssen. Da erschien es ihnen als einziger Weg, dass ihr gemeinsames Kind so lange leben sollte, wie es konnte. Gleichwohl waren die Tage bis zur Geburt dramatisch. Es kam dann auch früher als erwartet zur Welt und starb nach drei Tagen in den Armen seiner Eltern. Die Klinik begleitete diese Situation mit Sensibilität und Respekt. Der Pfarrer beerdigte das Kind und weitere Gespräche mit der Schwangerenkonfliktberatung dienten dazu, diese gemeinsame Geschichte aufzuarbeiten. Letztendlich ging die Partnerschaft der Eltern gestärkt aus dieser dramatischen Episode ihres Lebens hervor. Sie hatten ihrem Kind das bisschen Leben gegönnt und ihm seine Würde und sein Recht belassen.
Flyer der SkF-Beratungsstellen im Bistum Augsburg: