Vom würdigen Ende des Menschen
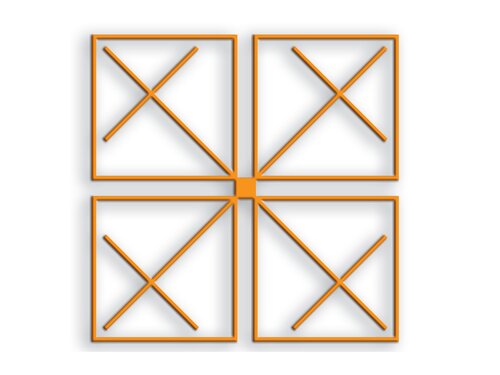
Dass mit dem assistierten Suizid ein Bereich berührt wird, der das christliche Gewissen zutiefst berührt, machte Prälat Dr. Bertram Meier in der Vesper deutlich, mit der die Veranstaltung begann: „Der Mensch darf nicht alles, was er kann. Er hat sich das Leben nicht selbst gegeben, deshalb darf er es sich auch selbst nicht nehmen.“
Die juristische Sicht
Schon im Gebrauch der Wörter unterscheidet sich die Alltagssprache häufig von der des Juristen. Auch die Sichtweise ist eine andere, da bspw. nicht alles gesetzlich verboten ist, was ethisch nicht in Ordnung ist. Prof. Henning Rosenau sieht als Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales Straf- und Strafprozessrecht, Medizin- und Biorecht an der Universität Augsburg macht in der Suizidfrage das Recht jedes Menschen auf Selbstbestimmung geltend, wie es für ihn in den ersten beiden Artikeln des Grundgesetzes zum Ausdruck kommt:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ (Art. 1 Abs. 1)
„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.“ (Art 2 Abs 1)
Aus der Verbindung dieser beiden Artikel ergebe sich das Selbstbestimmungsrecht, welches auch das eigene Sterben umfasse. Der Gesetzgeber habe dies mit dem Patientenverfügungsgesetz 2009 ausdrücklich anerkannt.
Rosenau legte ausführlich dar, dass weder der Suizid strafbar ist noch die Beihilfe dazu. Nach dem Willen einiger Politiker soll sich das im November ändern. Was dann vom Deutschen Bundestag Gesetzesform bekommen soll, ist die Kriminalisierung der Beihilfe zum Suizid, also die Strafbarkeit des assistierten Suizids für die helfende Person. Um einen solchen handelt es sich, wenn der Sterbewillige frei, selbstbestimmt und eigenverantwortlich beschlossen hat, sein Leben zu beenden, und wenn er dies selbst tut, also das Geschehen auch in der Hand hat. Bislang ist es nicht strafbar, dem Suizidanten für seine Tat ein geeignetes Mittel zu besorgen.
Strafbar sind allerdings Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz und Betäubungsmittelgesetz. Assistiert ein Arzt bei einer Selbsttötung, kann er zudem gegen seine Standesregeln verstoßen. So schreibt die „(Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte (Stand 2011)“ der Bundesärztekammer:
„Sie [die Ärzte] dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.“ (§ 16)
Die „Berufsordnung für die Ärzte Bayerns“ der Bayerischen Landesärztekammer formuliert es hingegen flexibel:
„Der Arzt hat Sterbende unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung ihres Willens beizustehen.“ (§ 16)
Rosenau spricht von einem „Standesrechtlichen Flickenteppich“ und sieht die Ärzteschaft aufgefordert, die ärztliche Suizidbeihilfe zuzulassen. Hintergrund ist der Beschluss des 66. Deutschen Juristentages in Stuttgart (2006):
„Die ausnahmslos standesrechtliche Missbilligung des ärztlich assistierten Suizids sollte einer differenzierten Beurteilung weichen, welche die Mitwirkung des Arztes (bei) ... Patienten mit unerträglichen, ... nicht ausreichend zu lindernden Leiden als ... auch ethisch vertretbare Form der Sterbebegleitung toleriert.“
Wären die Ärzte zur Mitwirkung am Suizid bereit, so Rosenau, erledigte sich das Thema organisierter bis kommerzieller Sterbehilfeorganisationen von selbst. Umgekehrt entfielen die Ärzte als Vertrauenspersonen des Patienten: Da sie dessen letzte Entscheidung nicht mehr mittragen könnten, würden sie gar nicht erst aufgesucht, sondern stattdessen die Organisationen, denen man letztlich kommerzielles Treiben unterstelle. Aus Rosenaus Sicht bewirkt also eine Gesetzesverschärfung das Gegenteil des Beabsichtigten.
Die Diskussion um den assistierten Suizid
Aber enthält diese Sicht des Strafrechtlers schon alle Aspekte? So stellten sich in einem Gespräch am Rande der Informationsveranstaltung folgende Fragen: Es ist doch wohl nur eine kleine Minderheit schwerstkranker oder unheilbarer Patienten, die ernsthaft über ein freiwilliges Ausscheiden aus dem Leben nachdenkt. Diese vergleichsweise sehr kleine Gruppe würde sich vergrößern, kämen Menschen zum Arzt, die ohne ein solches Leiden Suizidabsichten hegen. Um ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen: Es nehmen sich – mit Schwankungen nach oben und unten – jährlich etwa 10.000 Menschen das Leben. Das entspricht etwa der durchschnittlichen Zahl der jährlichen Patientenkontakte eines Arztes.
Die Vertrauensstellung des Arztes kann sich aber nicht nur an der sehr kleinen Gruppe der von Selbsttötungsgedanken Geplagten orientieren, selbst wenn es wünschenswert ist, dass diese einen Ansprechpartner haben, dem sie sich anvertrauen können. Möchte denn das Gros der Patienten Ärzte, die bereit sind, einem ein tödliches Gift auszuhändigen? Kann für den Patienten glaubwürdig Heiler sein, wer beim Töten hilft? Würde der Arzt das Stigma des „Todesengels“ jemals wieder loswerden, gehörte dies zu seinem Berufsethos?
Und selbst wenn man an diejenigen Menschen denkt, die Suizidabsichten hegen: Was würde es für ihre Bereitschaft zum Suizid bedeuten, wäre er gleichsam beim Hausarzt zu haben?
Einige der auf Prof. Rosenaus Referat folgenden Beiträge sahen deshalb Ähnlichkeiten mit der seinerzeitigen Abtreibungsdiskussion. Befürworter einer gesetzlichen Liberalisierung behaupteten, diese entspräche dem Selbstbestimmungsrecht der Frau, die Frauen ließen sonst im Ausland oder unter zweifelhaften Umständen abtreiben. Gegner einer Liberalisierung weisen auf den Druck hin, der durch mangelnden gesetzlichen Schutz des Kindes im Mutterleib einerseits und Schwangerschaftsvoruntersuchungen andererseits aufgebaut wird.
Die kirchliche Position
Prof. Gerda Riedl, die zu Beginn der Tagung die Position des Lehramts der Kirche erläutert hatte, erinnerte an – den leider fehlenden - Alois Glück, der Ärztekammerpräsident Montgomery zitiert hatte:
„Mich treibt eine große Sorge um: Wenn es einen so einfachen Weg zur Selbsttötung gibt, entsteht Druck auf schwerstkranke Menschen, ihren Angehörigen am Ende des Lebens nicht zur Last zu fallen“, warnt Ärztekammerpräsident Frank Ulrich Montgomery.
Ist diese Sorge begründet? Dafür spricht nachdrücklich die Erfahrung von Eltern, wenn bei den Schwangerenvorsorgeuntersuchungen festgestellt wurde, das Kind wird eine Behinderung haben und sie sich trotzdem gegen die Abtreibung, die Tötung des Kindes, entscheiden. Es ist heute nicht mehr die Ausnahme sondern eher die Regel, dass sich die Eltern nach der Geburt wegen diesem Kind rechtfertigen müssen. „Das hat doch nicht sein müssen, wie können Sie sich das selbst, dem Kind und im Hinblick auf die hohen Kosten der Gesellschaft zumuten?!“
Gerade das kurze Einleitungsreferat von Frau Prof. Riedl war ein deutlicher Hinweis darauf, dass nur eine Ausweitung der Perspektive, eine Einbeziehung unterschiedlicher Faktoren und Ebenen dem Phänomen des Sterbewunsches gerecht zu werden vermag. Wird der Mensch als Ganzer gesehen, der mit dem Tod sein Leben beschließt, so ist diese letzte Phase, die des Sterbens, vielleicht seine größte Aufgabe. Sie wurde, so Riedl, in unserer Kultur traditionell im Kreise der Familie, unter Anteilnahme der Gemeinde, begleitet von einem Seelsorger, der die Sakramente spendete, geleistet. Der Leichnam verblieb zunächst im Hause, wo er aufgebahrt wurde, damit Verwandte, Bekannte und Freunde Abschied nehmen und gemeinsam mit den Angehörigen für das Seelenheil des Verstorbenen beten konnten. Nachts hielt man Totenwache bei der Leiche. Heute kann es wohl eher als Normalfall angesehen werden, schwerstkrank im Krankenhaus zu landen und dort – oder in den letzten Jahrzehnten immerhin und immer öfter: in einem Hospiz – zu sterben. Die Gefahr, in seiner letzten Stunde allein zu sein oder mit Schläuchen und Kanülen bestückt einer Apparatemedizin ausgeliefert, erzeugt, so Riedl, „mehr Angst vor dem Sterben als vor dem Tod“. Auch dem Danach kommt immer mehr die Kultur abhanden, wenn kein Grabstein mehr an einen Menschen erinnert, sondern die Totenasche, so wollen es viele, in einem „Friedwald“ vergraben wird, „naturbestattet“.
Tod und Sterben werden in den Familien nur noch minimal erlebt, sie sind nur medial präsent, im Fernsehen. Es liegt nahe, dass man dieses Verdrängte, das sich ja nicht leugnen und nicht eliminieren lässt, allzu gerne komplett im Griff hätte, seinen Schrecken bannen möchte, indem man es selbst in die Hand nimmt, selbst entscheidet, selbst durchführt. Aber es bleibt gleichwohl unverfügbar, weil jene Krankheiten und Unfälle, deren tödliches Ende man beschleunigt herbeiführen möchte, weder als solche noch in ihrer jeweiligen Erscheinungsform geplant sind.
Prof. Gerda Riedl: „Wir müssen den Tod wieder zurückholen in unser Leben, so paradox es klingen mag.“ Wir sollten uns mit ihm konfrontieren, miteinander darüber sprechen.
Der christliche Standpunkt scheint diese realistische und ganzheitliche Sicht noch einmal zu bestätigen. „Die Kirche mutet uns zu, unser Leben auch dann noch weiterzuleben, wenn wir es selbst nicht mehr für lebenswert erachten“, so Riedl.
„Wir sind verpflichtet, es dankbar entgegenzunehmen und es zu seiner Ehre und zum Heil unserer Seele zu bewahren. Wir sind nur Verwalter, nicht Eigentümer des Lebens, das Gott uns anvertraut hat. Wir dürfen darüber nicht verfügen“,
zitierte sie den Katechismus der Katholischen Kirche (Nr. 2280). Die christliche Lehre hat ihren biblischen Grund im Tötungsverbot der Zehn Gebote, welches in der Bergpredigt noch radikalisiert wurde:
„Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist: Du sollst nicht töten; wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein; und wer zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf!, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; wer aber zu ihm sagt: Du (gottloser) Narr!, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein.“
Die Klarheit der kirchlichen Position, die nicht nur dem Einzelnen jene große Aufgabe des Sterbens, der Annahme der Unverfügbarkeit des Lebens, die dankbare Rückgabe dieses Geschenkes abfordert, fordert nicht nur das genannte Umfeld einer Sterbekultur, sondern einen leidsensiblen Umgang der Gesellschaft und jedes Einzelnen. Jeder Mensch sollte die Möglichkeit haben, mit optimaler Schmerzlinderung versorgt zu sein (Palliativmedizin) und seinen Lebensabend nach Möglichkeit in seiner gewohnten Umgebung (ambulante Hospizdienste) oder einer geeigneten Einrichtung (Hospiz) verbringen.
Die Kirche fällt übrigens schon ein halbes Jahrhundert kein Urteil mehr über den, der selbst Hand an sich gelegt hat. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sind die Zeiten vorbei, in denen dem „Selbstmörder“ die kirchliche Bestattung verwehrt wurde. Man schloss sich damals der medizinischen Sicht an, ein solcher Schritt zeuge von einer psychischen Problematik. Auch dem heutigen Pochen auf das Selbstbestimmungsrecht des Menschen, wie es der Jurist Rosenau darstellte, sollte der häufig depressive Hintergrund von Suizidfällen ein Hinweis sein, dass nur sehr bedingt von der freien Entscheidung des Menschen gegen sein eigenes Leben auszugehen ist.
Michael Widmann

